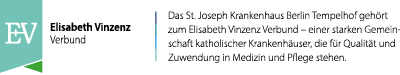Laufende Studien
LARS Studie
Prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie zur Erfassung des Low Anterior Resection Syndroms (LARS) nach einer anterioren Rektumresektion.
Ein LARSyndrom zeigt Beschwerden auf wie Harndrang, Stuhlinkontinenz, erhöhte Stuhlfrequenz, Blähungen, erschwerte Darmentleerung. Es gibt einen LARS Score, der den Schweregrad der Darmstörungen einteilt.
Ziel der Studie ist die Erfassung von Daten:
-
Auftreten von Darmbeschwerden vor der Behandlung
-
Beeinträchtigung der Lebensqualität
-
Auftreten von LARS nach erfolgter neoadjuvanter Chemo-Radiotherapie
-
Auftreten von LARS nach Rektumresektion
-
Wirksamkeit der unterschiedlichen Therapien
Einschlusskriterien
Patientinnen und Patienten mit einem histologisch gesichertem Rektumkarzinom, mindestens 18 Jahre und eine geplante Sphinkter erhaltende OP ± RCTx (Bestrahlung – Chemotherapie)